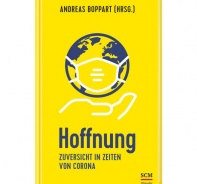Sommer-Serie
Andrea Wegener: «Notstand ist normal»
Zuversicht und Hoffnung während der Coronazeit? Genau diesem Thema widmete Andreas Boppart, Missionsleiter von Campus für Christus, ein Buch. Er lässt dabei verschiedene Persönlichkeiten zu Wort kommen. Den Start macht Andrea Wegener. Sie berichtet, wie sie die Coronakrise im Flüchtlingscamp Moria auf der Insel Lesbos erlebt und was ihr dabei Hoffnung gibt.Es hat gestern geregnet. Und wie so oft war die Kanalisation überfordert: Vor dem Eingang zum Camp schwimmen in einer Pfütze aus Abwasser Flöckchen von Exkrementen. Der Gestank lässt mich würgen, als ich möglichst schnell hindurchstapfe. Der Polizist, der sonst mein Namensschild kontrollieren würde, hält sich angeekelt seine Corona-Gesichtsmaske vor Mund und Nase und winkt mich entnervt durch. Willkommen in Moria!
Das Leben in Lesbos
Seit eineinhalb Jahren arbeite ich im berühmt-berüchtigten Hotspot Moria auf der Insel Lesbos am Rande Europas. Bis zu 20‘000 Menschen aus rund 60 ethnischen Gruppen von Sierra Leone über Afghanistan bis Bangladesch hausen hier auf einem Gelände, das ursprünglich für knapp 3'000 angelegt war, die meisten illegal in Olivenhainen um das eigentliche Camp herum, ohne Strom und manchmal mit einigen hundert Metern Fussweg zum nächsten Waschbecken. Viele haben Fieber, psychische Probleme oder schlimme Hautausschläge, aber zu den Ärzten auf dem Gelände kommt man inzwischen nur noch mit lebensbedrohlichen Notfällen. Messerstechereien sind die übliche Methode, Konflikte zu klären; gerade letzte Woche ist wieder einer der unbegleiteten Minderjährigen dabei umgekommen. Die Polizei patrouilliert schon lange nicht mehr im Olivenhain; dort herrscht das Recht des Stärkeren. Viele, gerade auch Familien mit kleinen Kindern, leben in ständiger Anspannung. Sie wissen nicht, wie viele Monate oder gar Jahre sie hier ausharren müssen, nur um am Ende vielleicht doch in ihre von Terror und Armut zerfressene Heimat deportiert zu werden.
Hinter dem, was einige Sätze hier nur grob skizzieren, stecken 20'000 Einzelschicksale: Die 13-jährige Afghanin, die den Geschäftspartner ihres Vaters heiraten sollte und mit ihrer Mutter vor ihrem Clan geflüchtet ist. Die sechsköpfige Familie, deren Ältester vor vier Jahren beim Heimweg von der Schule von einer Mine zerrissen wurde und deren andere Kinder seither keinen Unterricht mehr besucht haben – die Jüngste hat seitdem kein Wort gesprochen. Der hochrangige Mitarbeiter eines Ministeriums, der um sein Leben fürchten muss, seit sich eine neue Regierung an die Macht putschte. Der Elfjährige, der mit seinem 16-jährigen Cousin nach Moria gekommen ist und nun ohne diesen in der Schutzzone für unbegleitete Kinder unter 14 Jahren untergekommen ist.
Die Dunkelheit und Perspektivlosigkeit sind mit Händen zu greifen. Was anderswo Ausnahmezustand wäre, ist hier so normal, dass Krisen ineinander verschwimmen. Was war vorletzte Woche noch einmal zuerst: Das Feuer, bei dem ein Kind umkam und 200 Menschen obdachlos wurden, oder der Streit der verfeindeten afghanischen Banden? Mit wie vielen Panikattacken haben meine jungen Ehrenamtlichen es in dieser Woche unter den unbegleiteten Minderjährigen zu tun gehabt und mit wie vielen Selbstmordversuchen unter den Frauen? Ist es wirklich erst wenige Wochen her, dass Hilfsorganisationen unter Beschuss gerieten und auch einige meiner Helferinnen von Einheimischen angegriffen wurden? Es kommt mir ganz surreal weit weg vor.
Corona macht alles noch schwieriger
Und zu all dem kommt nun also auch noch Corona hinzu! Die Aussicht, dass das Virus im Camp ankommen könnte, wo es sich angesichts der Enge und der hygienischen Zustände ungehindert ausbreiten würde, während die medizinische Versorgung auf der Insel und erst recht im Camp jetzt schon völlig unzureichend ist, hat bei manchen Helfern und Camp-Bewohnern grosse Angst ausgelöst. Es ist ein Wettlauf gegen die Zeit, die Hochrisikogruppen zu evakuieren und wenigstens notdürftige Quarantäne- und Isolierstationen aufzubauen, während gleichzeitig immer mehr Helfer die Insel verlassen. Als eine der wenigen Hilfsorganisationen, die noch in Moria aktiv sind und für einen Rest Stabilität sorgen, gelten wir wohl als systemrelevant und dürfen zur Arbeit gehen. Ansonsten herrscht eine strenge Ausgangssperre: Unsere Freizeit verbringen wir in unseren Wohnungen. Fast alle Treffen und Aktivitäten, die uns früher einen Ausgleich zur emotional aufreibenden Arbeit geschaffen haben, sind nun unmöglich. Es ist anstrengend! Zu unserem «normalen» Ausnahmezustand hat sich der globale Corona-Ausnahmezustand hinzugesellt.«Was gibt dir Hoffnung?»
«Wie hältst du das nur aus?», fragen mich Freunde manchmal, oder auch: «Was gibt dir Hoffnung?» Es stimmt: Ohne Hoffnung kann man hier nicht lange überleben – auch als Helfer nicht. Es läge so nahe, die Koffer zu packen oder zumindest innerlich aufzugeben, bitter oder zynisch zu werden oder nur noch Dienst nach Vorschrift zu machen, ohne Liebe zu den Menschen.
Ein paar Dinge buchstabiere ich in den letzten anderthalb Jahren immer wieder neu, die mir helfen, die Zuversicht aufrechtzuerhalten.
Ich bin immer wieder begeistert, wie tragfähig das christliche Welt- und Menschenbild ist, das mir meine Eltern und die Gemeinde meiner Kindheit vermittelt haben. Darin ist Platz für das Unordentliche, das Dunkle, die Ungerechtigkeit, all das Hässliche und die Gewalt, die uns in Moria zu schaffen machen – all das, was die Bewohner unseres Camps bei ihrer Flucht hinter sich lassen wollten und das sie in ihren Herzen dann doch selbst mitgebracht haben. Die Bibel behauptet nicht, dass wir Menschen im Grunde alle eigentlich ganz gut sind und dass wir alle friedlich miteinander leben würden, wenn es nur keinen religiösen Extremismus, keine patriarchalischen Strukturen, westlichen Imperialismus oder – hier kann man jetzt das Feindbild seiner Wahl einsetzen – gäbe.
Wir Menschen sind mit uns selbst, miteinander und mit der Welt nicht im Reinen, weil wir mit unserem Schöpfer nicht im Reinen sind. Wir sind Opfer und machen andere zu Opfern. Selbst als Helfende können wir uns manchen Dynamiken von Ungleichbehandlung und Machtmissbrauch kaum entziehen. Politische Lösungen sind wichtig und ich bin sehr dankbar für meine Aktivistenfreunde, die sich für diese grossen Lösungen leidenschaftlich einsetzen. Aber meine Hoffnung ist nicht, dass wir die Welt damit stückweise immer besser machen, bis sie irgendwann ganz im Lot ist.
Seuchen wird es immer geben
Die Bibel ist ganz realistisch: Ungerechtigkeit, Naturkatastrophen, Krieg, Armut und – obwohl uns die Corona-Krise so unvorbereitet traf! – Seuchen wird es immer geben. Wir sind nicht die ersten, die irgendwie damit umgehen müssen. Wie gut, dass es vor uns schon Generationen von Menschen gab, die in schwierigen Situationen die Hoffnung aufrechterhalten haben! Im Römerbrief gibt es einige Verse, die mich sehr berühren. (Römer, Kapitel 8, Vers 18ff.)
Das klingt für moderne Ohren ein bisschen verschwurbelt und es lohnt sich unbedingt, etwas länger auf diesen Versen herumzukauen. Aber einige Gedanken stecken darin, die ich sehr hoffnungsvoll finde.
Dem Leben einen Anker verleihen
Diese Welt mit ihrem Schmerz hat nicht das letzte Wort. Es geht hier nicht um eine billige Jenseitsvertröstung, sondern um eine Perspektive, die unserem Leben im Hier und Jetzt einen Anker verleiht. Am Ende wird tatsächlich alles gut werden und wir werden dabei sein! Menschen, die das wissen, müssen nicht aus FOMO (Fear of missing out, also der Angst, etwas zu verpassen) alles Schöne in dieses eine Leben packen, Leiden um jeden Preis vermeiden und die Erfüllung eigener Wünsche zum Lebensinhalt machen.
Das ist ungemein befreiend – so befreiend übrigens, dass hier und da vielleicht sogar noch ein Restchen Energie für die Nächstenliebe übrig bleibt, zu der wir aufgefordert und befähigt sind. Und dabei müssen wir gar nicht riesig denken. Mir ist bewusst: Ich werde Moria nicht retten und die Welt erst recht nicht! Aber ich kann das tun, was vor meinen Füssen liegt. Ich kann aus meiner Komfortzone heraus- und in die Exkrementenpfütze hineintreten und heute mit einer kleinen handfesten Tat das Leben von einem einzelnen Menschen ein kleines bisschen erträglicher machen.
Seufzen statt beten
Auch Seufzen ist laut Paulus, dem Autor des Römerbriefs, in Ordnung. Dass wir uns zusammenreissen, alles nicht so tragisch nehmen und Schmerz wegdrücken, ist nicht der Weg, den er hier vorschlägt. Es ist ein sehr starkes, drastisches Bild von einer ganzen Welt, die in den Wehen liegt, sich windet, seufzt und schreit – und wir mit ihr. Wir wollen, dass endlich, endlich alles gut wird. Und das ist auch gut so! Gott hat diese Sehnsucht in uns hineingelegt – wir sind «auf Hoffnung hin» gerettet.
Ebenso wenig müssen wir auf alles eine Antwort haben. «Wir wissen nicht, was wir beten sollen», heisst es. Danke, Paulus! Wenn du schon nicht wusstest, welche Lösungen du im Gebet Gott vorschlagen solltest, muss ich das auch nicht! In einer höchst komplexen Situation, wie sie sich in Moria darstellt, weiss ich meistens nicht, was eine gute Lösung wäre oder wo ich mit dem Beten überhaupt anfangen soll. Dann ist dieses wortlose Seufzen in Ordnung, oder der Schrei um Gottes Eingreifen, den Generationen von Gläubigen schon vor mir ausgesprochen haben: Kyrie Eleison! Herr, erbarme dich! Ich habe in den letzten Monaten die Psalmen neu entdeckt, die so viele Gedanken und Emotionen in Worte fassen, die in mir ungeordnet durcheinanderpurzeln. Und die dann doch auch immer wieder zu dem Ergebnis kommen: Gott ist Gott und ich kann ihm vertrauen, auch wenn ich keine Antwort habe.
Hoffnung: Das sehen, was man nicht sieht
Schliesslich ganz wichtig: Hoffnung bedeutet, das zu sehen, was man (noch) nicht sieht. Wenn alles schon klar wäre, bräuchte man ja keine Hoffnung mehr – so würde ich es ausdrücken. Das finde ich in Moria tatsächlich die spannendste Übung. Wenn ich mit Gottes Augen zu sehen beginne, stellt sich ein ganz anderes Bild dar als überquellende Abwasserrohre und messerschwingende Halbstarke.
Ich habe diesen furchtbaren Ort in den letzten eineinhalb Jahren immer mehr lieben gelernt, je mehr ich seine Menschen lieben gelernt habe: Ich habe ihr unglaubliches Durchhalten in ausserordentlich widrigen Umständen bewundern gelernt. Ich schätze ihre Findigkeit, aus Nichts etwas zu machen: Aus Europaletten und Planen bauen sie Brücken, stabile Unterkünfte für ihre Familien und, ja, Kioske, Friseursalons und Restaurants! Und mich berühren das Lächeln und die Schönheit so vieler Männer, Frauen und Kinder aus aller Welt, die kein Trauma ganz zerstören konnte.
Gott hat jeden dieser Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen. Zusammen bilden sie so viel von seiner Kreativität und Vielfalt ab, dass ich staune! Er hat sie unendlich mehr lieb, als ich das je könnte. Und er hat meinen Kollegen und mir die ehrenvolle Aufgabe gegeben, im Camp die Hände und Füsse von Jesus zu sein. Gott begegnet den Bewohnern durch uns, so dass sie ihn kennenlernen können. Das alles kann ich nur sehen, wenn ich mir von Gott Augen der Hoffnung geben lasse. Auch wenn ich mir das im Moment nicht vorstellen kann: Selbst Moria und alles Schwierige, was wir hier erleben, webt er in seinen grossen Plan mit der Welt ein.
«Ich sehe was, was du nicht siehst …!», scheint Gott manchmal zu sagen. Und dann schenkt er mir seine Sicht der Dinge und ich habe Hoffnung für den nächsten Tag. Auch und gerade in Moria.
Zur Person:
Andrea Wegener, von Campus für Christus nach Lesbos ausgesandt, ist die operative Leiterin der griechischen Hilfsorganisation EuroRelief im Camp Moria. Sie spricht Englisch mit ihrem Team, Deutsch mit Jesus und hofft, dass ihre Katze ihr schlechtes Griechisch versteht.Dieser Text erschien zuerst im Buch «Hoffnung – Zuversicht in Zeiten von Corona» von Andreas Boppart.
Zum Thema:
Dossier Hoffnung in der Krise
Hoffnung in Corona-Zeiten: Viel mehr als ein «Warten auf Godot»
Liebe in Zeiten von Corona: Wo die Welt immer noch schreit
Wo die Welt schreit: Andrea Wegener unter Geflüchteten

Autor: Andrea Wegener
Quelle: Buch «Hoffnung – Zuversicht in Zeiten von Corona»